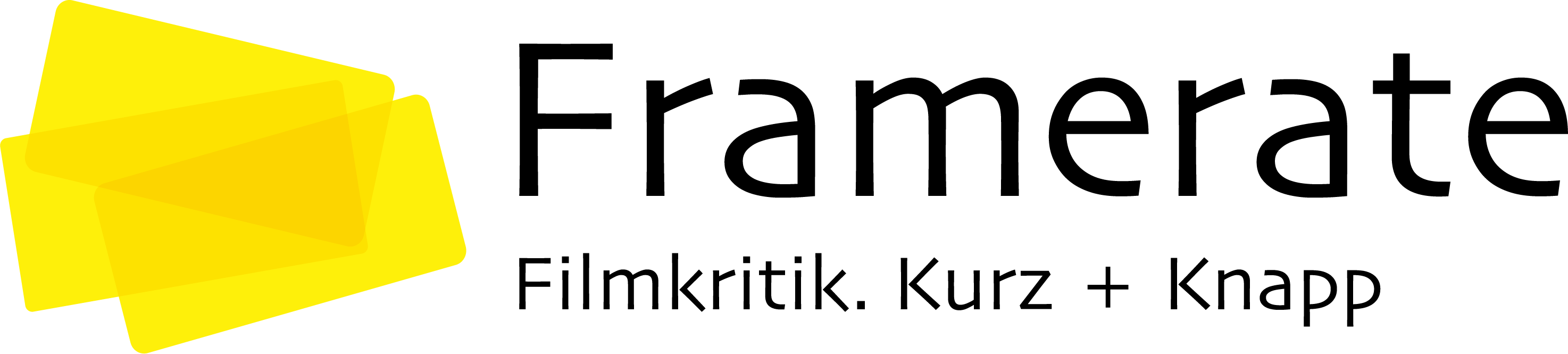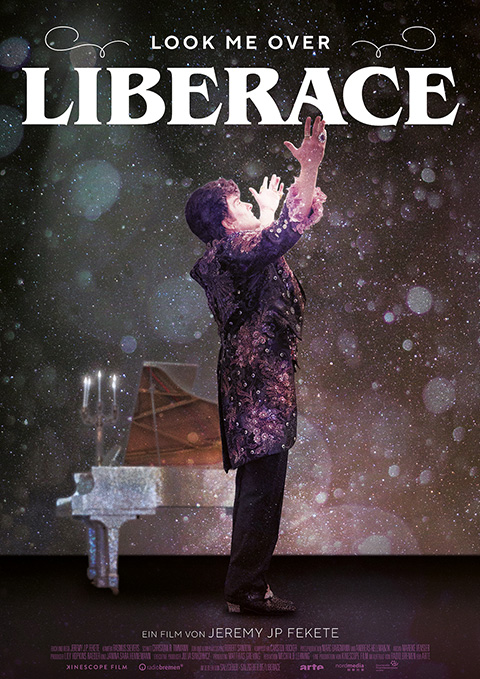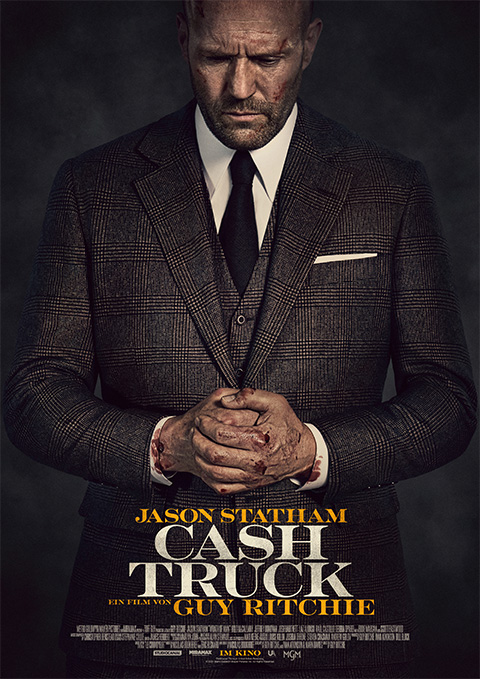THE FATHER
Es war als Höhepunkt der Oscarverleihung 2021 geplant: Ganz am Ende der Show sollte Chadwick Boseman den Preis als bester Hauptdarsteller bekommen, posthum natürlich, Boseman war im August 2020 einem Krebsleiden erlegen. Doch es kam anders: Nicht nur ging die von Steven Soderbergh produzierte Show als die stümperhafteste und langweiligste in die Annalen ein, statt Boseman gewann ein alter weißer CIS-Mann den Oscar für die beste männliche Hauptrolle: Sir Anthony Hopkins.
Nun, da es in Deutschland endlich Gelegenheit gibt, Hopkins in seiner prämierten Rolle zu sehen, wird klar: Den Oscar hat er vollkommen zu Recht bekommen. Hopkins spielt den an Demenz erkrankten Anthony, der in einem Labyrinth aus Verwirrungen, Erinnerungslücken und Halluzinationen gefangen ist. Das Besondere: Florian Zeller lässt die Zuschauer in seinem Regiedebüt die Welt mit Anthonys Augen sehen. Im Gegensatz zu Julianne Moore in „Still Alice“ erhält Anthony keine Diagnose und muss lernen, damit umzugehen – Anthony ist schon krank und hat sich größtenteils von der Realität verabschiedet.




Personen wechseln die Erscheinung, die Einrichtung der Wohnung verändert sich, Gespräche beginnen, enden und wiederholen sich. Mithilfe des raffinierten Setdesigns von Ausstatter Peter Francis gelingt Zeller die Innenansicht eines Bewusstseins in Auflösung. Der Bezug zu Orten, Personen und Zeit kommt und geht, zerrinnt.
„The Father“ ist ein clever konstruiertes, ergreifendes Drama. Ernsthaft und gleichzeitig verrückt, fast so, als habe Michael Haneke eine Twilight Zone-Episode inszeniert. Großartig (wieder mal) auch Olivia Colman als todtraurige Tochter, die ihrem Vater hilflos beim langsamen Verschwinden zusehen muss.
FAZIT
Herzzerreißend.
INFOS ZUM FILM
Originaltitel „The Father“
UK 2020
97 min
Regie Florian Zeller
Kinostart 26. August 2021

alle Bilder © TOBIS FILM GMBH