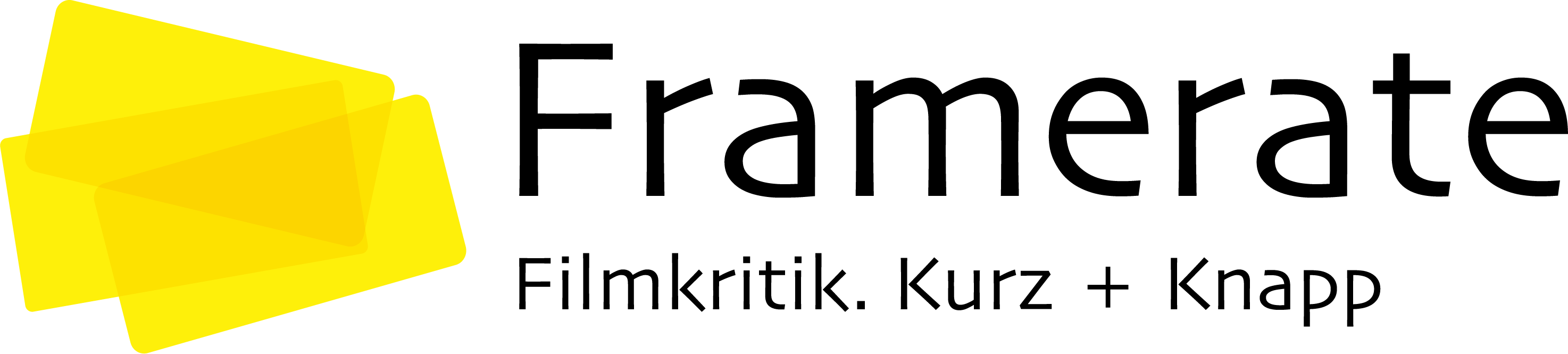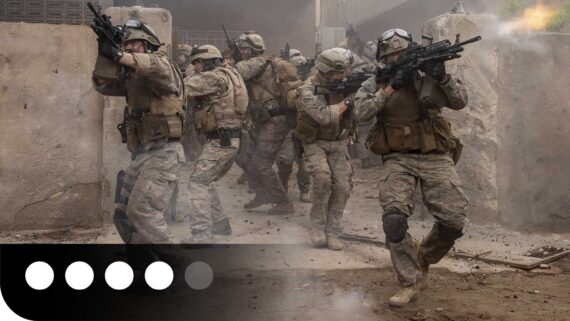STERBEN
Ein allerletztes Wort zur Berlinale 2024: Der Wettbewerb schwach, die Preisvergabe schwächer. STERBEN gewann den silbernen Drehbuch-Bären, verdient hätte er den goldenen Bären als bester Film.
Ab 25. April 2024 im Kino

Matthias Glasners grandioses Familienepos STERBEN handelt natürlich genau vom Gegenteil, nämlich dem Leben in all seinen furchtbaren und furchtbar schönen Facetten. Die über dreistündige Drama-Komödie erforscht die Intensität unseres Daseins angesichts des Todes mit einer Mischung aus Zartheit, Brutalität, absurder Komik und trauriger Schönheit. Dabei verschwimmt die Grenze zwischen bitter und lustig ständig.

Im Fokus steht Familie Lunnies: Lissy (Corinna Harfouch) ist Mitte 70 und froh, dass ihr dementer Mann endlich im Heim ist. Sohn Tom (Lars Eidinger), ein Dirigent, arbeitet zusammen mit seinem depressiven Freund Bernard (Robert Gwisdek) an der Komposition „Sterben“. Tochter Ellen (Lilith Stangenberg) hat ein Alkoholproblem und beginnt eine wilde Liebesgeschichte mit dem verheirateten Zahnarzt Sebastian (Ronald Zehrfeld).

Am schwächsten ist die Episode um Ellen, da hängt der Film ein bisschen durch. Ansonsten ist STERBEN voller guter Momente – die vielleicht beste zeigt Lars Eidinger und Corinna Harfouch im schmerzhaft wahrsten Mutter-Kind-Gespräch der Kinogeschichte. Wahnsinnig komisch und todtraurig zugleich. Allein dafür lohnt es sich.
INFOS ZUM FILM
Deutschland 2024
183 min
Regie Matthias Glasner

alle Bilder © Wild Bunch Germany