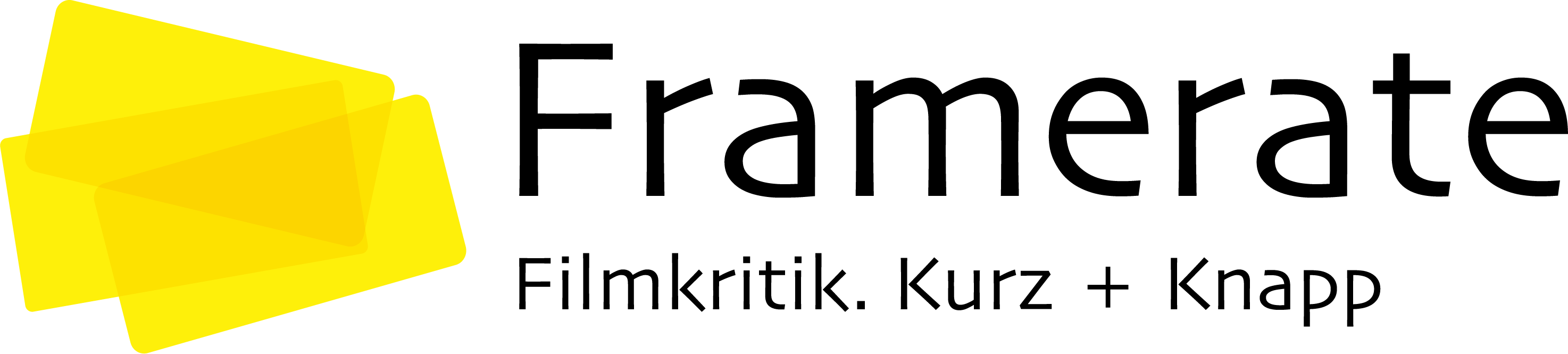Tattoos sind Scheiße. Das Stechen tut weh, das Entfernen noch mehr. Diese Wahrheit muss Bryon (Jamie Bell) am eigenen Leib erfahren. Nach seinem Entschluss, sich von seinen rassistischen White-Supremacy-Freunden loszusagen, wartet eine schmerzhafte Enttintungsprozedur auf ihn. Bei seinem Weg ins neue Leben helfen ihm ausgerechnet schwarze Menschenrechtsaktivisten und natürlich die Liebe, denn Freundin Julie hat mit dem Nazipack ebenso abgeschlossen.
Der israelische Filmemacher Guy Nattiv erzählt in seinem ersten US-Spielfilm die wahre Geschichte des Szeneaussteigers Bryon „Babs“ Widner. „Skin“ basiert auf Nattivs gleichnamigen, in diesem Jahr mit einem Oscar prämierten Kurzfilm.
FAZIT
Eindringliches und authentisches Thriller-Drama. Hervorragend besetzt, vor allem Jamie Bell („Billy Elliot“) überzeugt als bekehrter Rassist.
Originaltitel „Skin“
USA 2019
117 min
Regie Guy Nattiv
Kinostart 03. Oktober 2019