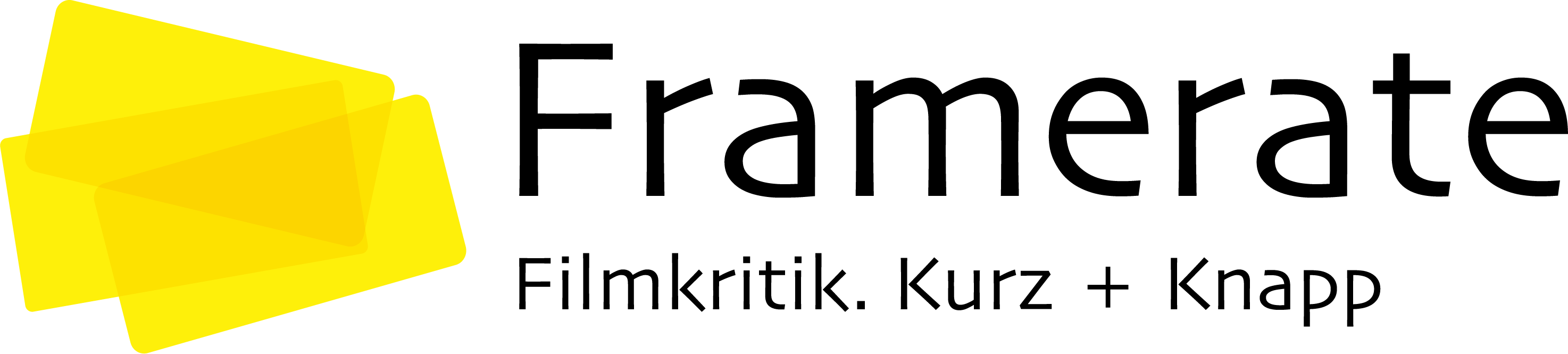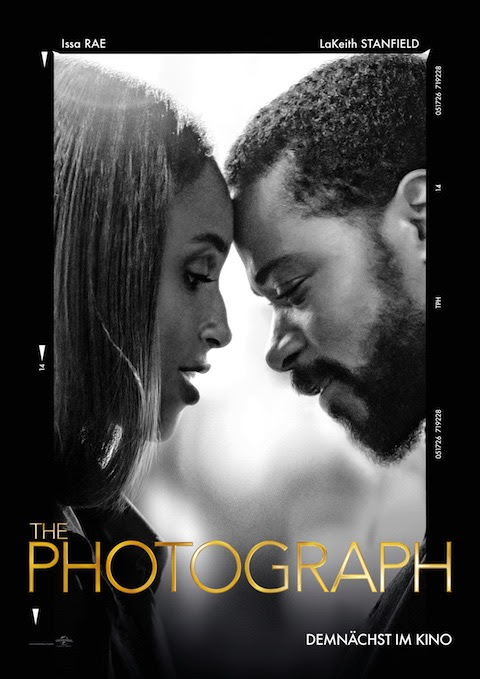THE MANY SAINTS OF NEWARK
Regisseur Alan Taylor findet offensichtlich Gefallen daran, es sich mit Hardcore-Fans zu verderben. Nach einhelliger Zuschauer- und Kritiker-Meinung hat er den schlechtesten Marvel-Film zu verantworten: „Thor: The Dark Kingdom“ (wenigstens bis „Eternals“ in die Kinos kam). Direkt danach drehte er „Terminator: Genesis“. Diese Fortsetzung fand so wenig Gefallen, dass anschließend das gesamte Franchise einem Reboot unterzogen wurde (ohne Erfolg). Nun legt sich Taylor mit einer besonders strengen Fangruppe an: „A Sopranos Story“ heißt sein neuer Film im Untertitel und ist ein Prequel zur legendären Mafiasaga.
Der unerwartete Tod von James Gandolfini vor acht Jahren machte alle Pläne, die preisgekrönte HBO-Serie jemals fortzusetzen, zunichte. Deren Abschluss (ein schlichter Schnitt auf Schwarz) wird von Fans bis heute als entweder genial oder enttäuschend empfunden. Statt das überraschend abrupte Ende aufzuklären, gibt es nun eine Reise zu den Anfängen. Die Rolle des jungen Tony Soprano spielt der seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnittene Michael Gandolfini. Ein genialer Besetzungscoup, Ähnlichkeit ganz ohne Computer-Tricks.



Im Mittelpunkt des Films steht Tonys Onkel Dickie Moltisanti. Ein schlimmer Finger, dem trotzdem die Sympathien des Publikums gehören. Als Mitglied der DiMeo-Verbrecherfamilie betreibt er den örtlichen Glücksspielring in Newark. Tony Soprano, noch ein Teenager, steht am Scheideweg: bürgerliches Leben oder dem Vorbild seines Onkels folgen und Berufsverbrecher werden? Wie die Geschichte ausgeht, ist bekannt.
Alan Taylor hat sich rehabilitiert. Auch ohne jemals eine Folge der Serie gesehen zu haben, funktioniert der Film. In zwei spannenden Stunden lernt der Zuschauer den Soprano-Clan in seinen mörderischen Anfängen kennen. Mit großem Aufwand und exzellenter Besetzung erzählt „The Many Saints of Newark“ eine epische Familiensaga, in der Erpressung und Gewalt Alltag sind. Sicher bleiben für Nicht-Kenner einige Verweise auf die Serie unverständlich, das macht aber nichts. „The Many Saints of Newark“ ist auch ohne Insiderwissen sehenswert.
INFOS ZUM FILM
Originaltitel „The Many Saints of Newark“
USA 2021
120 min
Regie Alan Taylor
Kinostart 04. November 2021

alle Bilder © Warner Bros. Entertainment Inc.